Chapter 20
Das Krankenhaus ragte wie ein riesiges, Unheil bringendes Monster vor mir auf. Alec und ich waren zweieinhalb Stunden gefahren, nur um jetzt seit weiteren zehn Minuten still schweigend im Auto zu sitzen. Ich war ihm dankbar dafür, dass er nicht versuchte, die Stille mit leeren Worten zu füllen. Wir wussten beide nicht, was uns hinter den Türen des Krankenhauses erwartete, doch dass die Situation nicht angenehm werden würde, das war klar.
„Ich bin bereit, wenn du es bist", sagte Alec nun doch. Ich nickte. Aber die Wahrheit war: Hierfür wäre ich wohl niemals bereit. Egal, ob wir noch drei Minuten mehr in diesem Auto verbrachten oder drei Stunden. Ich musste mich meinen Eltern stellen. Ich musste meinen sonst so unnahbaren Vater in einem Krankenhausbett liegen sehen. Ohne es also weiter hinauszuzögern stieß ich schwungvoll die Tür des Beifahrerplatzes auf.
Als wir die Eingangshalle des Krankenhauses betraten, stieg mir sofort der unangenehm stechende Geruch des Desinfektionsmittels in die Nase und mein Magen verkrampfte sich. Alec, der meine Unruhe spürte, nahm meine Hand in seine und verschränkte unsere Finger miteinander, bevor er mich zur Rezeption zog. Unwillkürlich glitt mein Blick einmal durch den großen Raum, wie um zu prüfen, ob es jemandem auffiel. Dann jedoch konzentrierte ich mich auf die junge, ziemlich müde dreinblickende Frau in weiße Kleidung vor mir.
„Edward Collins. Ich möchte bitte zu Edward Collins. Er ... Er hatte einen Herzinfarkt. Ich muss ihn sehen." Obwohl meine Stimme ein wenig stockte, brachte ich die Worte hervor ohne nochmal in Tränen auszubrechen. Die Frau klickte ein paar mal mit ihrer Maus, tippte etwas in ihren Computer ein und begann schließlich zu reden, ohne uns auch nur eines Blickes zu würdigen.
„Ich bin nicht befugt, irgendwelche Personen zu Mr. Collins zu lassen. Mrs. Collins hat uns da strikte Anweisungen gegeben. Tut mir Leid."
Ich blinzelte und brachte für ein paar Sekunden kein Wort heraus.
„Ich bin sein Sohn. Joshua Collins", meinte ich schließlich. Jetzt schaute die Rezeptionistin doch auf. Auf ihrem Gesicht erschien ein verkniffenes, mitleidiges Lächeln, das so gar nicht zu ihrem sonst so jungen Gesicht passte.
„Tut mir Leid", wiederholte sie und wandte sich erneut ihrem Computer zu. Ich war wie erstarrt. Meine Mutter – sie hatte dafür gesorgt, dass ich meinen Vater nicht sehen konnte.
„Aber ... Aber ich muss zu ihm. Ich bin ein Familienmitglied! Sagen Sie mir einfach die Zimmernummer und Sie sind uns ganz schnell los", bettelte ich. Diese Frau verstand es einfach nicht. Ich musste meinen Dad sehen.
„Wie schon gesagt: Es gab strikte Anweisungen. Ich muss Sie nun bitten zu gehen."
Ich war sprachlos. Und stinkwütend. Sie wollte mich, mir nichts dir nichts, aus dem Krankenhaus werfen!
„Und ich dachte immer, die Schwestern in Krankenhäusern würden sich um die Anliegen ihrer Patienten und deren Angehörigen sorgen! Aber das stimmt ganz offensichtlich nicht, sie kaltes, herzloses Mists -"
Mein Ausbruch wurde mit einem besänftigenden ‚Schsch' von Alec unterbrochen. Ehe ich noch mehr sagen konnte, das die Rezeptionistin dazu bewegen könnte, uns tatsächlich rauszuwerfen, zog er mich in Richtung des Warteraums, der durch eine Glaswand von der Eingangshalle abgetrennt war. Auch wenn ich gerade nichts weiter wollte, als diese Frau zur Schnecke zu machen, folgte ich ihm widerwillig. Einen bösen Blick über die Schulter konnte ich mir dennoch nicht verkneifen.
Im Wartebereich ließ ich mich auf einen der roten Plastikstühle fallen. Obgleich mich die Wut momentan beherrschte, so war sie doch nur dazu da, mich aufrecht zu halten. Sie diente der Verdrängung der Leere und Unsicherheit, die ich vorhin gefühlt hatte und die auch jetzt wieder darauf lauerten, sich in mir breit zu machen. Ich wusste nicht, wie lange ich mich an die Wut klammern konnte.
Plötzlich wurde mir ein kühler, feuchter Becher in die Hand gedrückt. Überrascht blickte ich auf, direkt in das Gesicht meines Freundes. Ich hatte schon fast vergessen, dass er hier war.
„Trink", befahl er. Ohne zu zögern trank ich den ganzen Becher mit dem Wasser, das von dem Trinkbrunnen ein paar Schritte weiter stammen musste, wobei ich mich in meiner Hast sogar leicht verschluckte.
„Danke", murmelte ich leise. Alec nickte und setzte sich neben mich, doch er war noch nicht fertig damit mir Befehle zu erteilen.
„Und jetzt gib mir dein Handy." Verwirrt schaute ich ihn an, tat dann aber, was er sagte. Ich beobachtete, wie er durch meine Kontaktliste scrollte, bis er gefunden hatte, was er suchte. Leider konnte ich nicht erkennen, wen er letztendlich anrief, da er sich ein Stück von mir abwandte. Stattdessen betrachtete ich die Schnürsenkel meiner Vans. Erneut blendete ich meine Welt aus, sodass ich nicht bemerkte, wann er letztlich auflegte.
„Es ist nicht deine Schuld."
Mit gerunzelter Stirn blickte ich meinen Freund an, als er nun doch beschloss, die Stille mit Worten zu füllen. Ich wunderte mich, woher er so genau wusste, was in mir vorging. Ich hatte ihm nämlich nicht gestanden, dass dies der Gedanke war, der mir ununterbrochen im Kopf umherschwirrte, seit ich ihm vorhin in der Umkleidekabine erzählt hatte, was passiert war.
„Ich kenne dich, Joshi", sagte er, sowie er meine Überraschung bemerkte. „Du bist seit wir sechs Jahre alt waren mein bester Freund. Ich weiß, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Aber es ist nicht deine Schuld. Nichts davon." Eindringlich sah er mich an und drückte mit seiner Hand meinen Schenkel. Meine Augen folgten der Bewegung kurz, bevor ich wieder hoch in sein Gesicht blickte.
„Aber wessen Schuld ist es dann?", flüsterte ich. Ich konnte ihm ansehen, dass er etwas sagen wollte – wahrscheinlich etwas über die Intoleranz und Verklemmtheit meiner Eltern –, aber er biss den Kiefer zusammen und ließ meine Frage unbeantwortet im Raum stehen. Er wusste, dass mir seine Wut auf meine Eltern jetzt nicht weiterhelfen würde.
Jedoch beugte er sich zu mir und legte seine Lippen auf meine. Er wollte mich wahrscheinlich nur trösten, doch ich konnte nichts dagegen tun, dass sich mein Körper umgehend versteifte. In dem Raum waren nur zwei weitere Familien, die eine mit Kind, und ich war mir sicher, dass sie ganz andere Probleme als zwei sich küssende Jungs hatten. Trotzdem konnte ich nichts gegen meine unwillkürliche Reaktion machen.
Alec löste sich von mir, sobald ihm meine angespannte Körperhaltung auffiel und schaute mich mit einer Mischung aus Kummer und Verletztheit an. Dass ich ihn nicht einmal jetzt küssen konnte, jetzt, wo er meine einzige Familie war, die mich nicht verabscheute, musste ihn stark treffen. Bevor er allerdings etwas sagen konnte, wurde die Tür energisch geöffnet. Ich drehte mich um ... und blickte direkt in das versteinerte Gesicht meiner Mutter. Mir brach der Schweiß aus. Hatte sie gesehen, wie Alec mich geküsst hatte? Schnell sprang ich auf, um Abstand zwischen uns zu schaffen. Mom ließ nicht durchblicken, ob sie von unserem Kuss etwas mitbekommen hatte.
„Joshua." Ihre Stimme klang noch härter als sonst und ich zuckte zusammen, als hätte sie mich geschlagen.
„Mom", hauchte ich. Neben ihr stand Candy, mit roten Augen und gepeinigter Miene. Sie musste es gewesen sein, die Alec angerufen hatte. Anders konnte ich mir nicht erklären, wie sie und meine Mutter nun vor uns standen. Das Rosa, in das sie sich tagtäglich kleidete, war heute so schrill und grell, dass ich sie für einen Moment nur anstarren konnte.
Jetzt passt die Farbe immerhin zu ihren geschwollenen Augen, schoss es mir durch den Kopf. Der Gedanke war so unangebracht, dass ich fast in hysterisches Gelächter ausgebrochen wäre. Zum Glück konnte ich es mir verkneifen. Mein Blick zuckte zurück zu meiner Mutter, die mich noch immer kühl musterte, ohne einen Hauch von Emotionen in ihrem Blick.
„Mom", sagte ich erneut und machte einen vorsichtigen Schritt auf sie zu. Ein Muskel in ihrem Kiefer zuckte.
„Du hättest nicht herkommen sollen, Joshua." Sie schaute mich nicht mal an, als sie mit mir sprach, sondern richtete ihre Aufmerksamkeit auf einen Punkt über meinem Kopf. Mir wurde schlecht.
Du bist so eklig. Menschen wie du gehören in die Verdammnis.
Galle stieg in meiner Kehle auf und ich keuchte leise.
„Atme", hörte ich da eine beruhigende Stimme knapp neben meinem Ohr. Alec war hinter mich getreten. Er hielt genügend Abstand von mir, doch allein seine Präsenz hinter mir zeigte mir, dass er mich unterstützen würde. Er würde mich auffangen, sollte ich fallen. Zumindest solange ich ihn ließ.
„Wie geht es ihm?", stellte ich die Frage, wegen der ich hergekommen war.
„Wie es ihm geht?!" Moms Stimme schraubte sich mindestens eine Oktave in die Höhe. „Wie geht es einem Vater wohl, wenn er gerade herausgefunden hat, dass sein Sohn ... Dass sein Sohn ..."
„Schwul ist?", bot ich leise an.
„In die Hölle kommen wird!", beendete meine Mutter ihren Satz. Ich zuckte zusammen. Es fühlte sich an, als hätte sie mir ein Messer direkt ins Herz gerammt. Es fühlte sich an, als würde ich langsam von innen ausbluten.
„Mom, ich bin immer noch derselbe, ich -", setzte ich an.
„Wag es ja nicht, mich Mom zu nennen." Diesmal blickte sie mir direkt in die Augen und ich wusste, dass ich das nicht mehr lange durchhielt. Ihre Reaktion war schlimmer als in meinen schlimmsten Albträumen. Aber eine Sache gab es noch, die ich wissen musste: „Wo ist Liz? Geht es ihr gut?"
„Elizabeth ist bei einer Freundin. Und denk ja nicht, dass du sie je wiedersehen darfst, solange du nicht zur Vernunft kommst!" Mit diesen letzten vernichtenden Worten drehte sie sich ruckartig um und stürmte aus dem Wartezimmer. Ich bildete mir ein, das erzürnte Klackern ihrer Schuhe auf dem Linoleumboden noch dann zu hören, als sich die Glastür schon längst geschlossen hatte.
„Es tut mir so leid, Joshua! Ich hab das nicht gewollt, du musst mir glauben. Bitte vergib mir."
Mein Blick zuckte zu Candy, die inzwischen weinte und schluchzte. Ich glaubte ihr, dass das hier nicht ihre Absicht gewesen war. Und wie sie da so stand, klein wie ein Häufchen Elend, tat sie mir sogar ein bisschen leid. Aber dann dachte ich an meine kleine Schwester, daran, dass ich sie nicht besuchen durfte, solange ich mit Alec zusammen war. Ich konnte ihr nicht verzeihen. Nicht jetzt und vielleicht niemals.
Arschficker!
Meine Beine zitterten und ich spürte, wie meine Mauern Stück für Stück in sich zusammenbrachen. Meine Knie knickten ein und ich sank auf den Boden, zusammen mit Alec, der mich so fest hielt, als wollte er versuchen, mich davor zu bewahren in tausend kleine Stücke zu zersplittern. Er presste mich an sich, als wollte er mich nie wieder gehen lassen und vor uns stand Candy, immer noch weinend. In diesem Moment wusste ich nicht, ob ich mich hiervon jemals erholen würde.
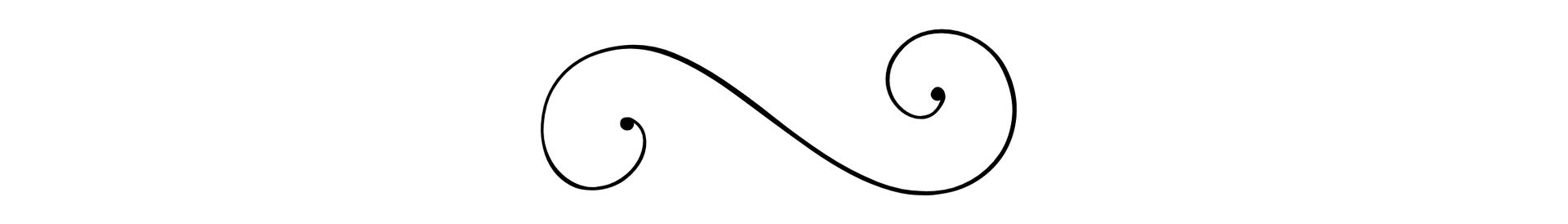
Guten Abend, ihr lieben Leutchen!
Hattet ihr einen angenehmen Tag? Ich hoffe Ja. 😊
Die Dramakurve steigt mit diesem Kap erneut drastisch an ... Was haltet ihr davon?
Könntet ihr an Joshuas Stelle Candy vergeben?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro