𝟙𝟚・Ein schwarzer Tag
Die Sonnenstrahlen dieses herrlichen Frühlingstages tanzen auf den gepflasterten Wegen des ruhigen Wohnviertels. Ich schließe die Augen und spüre, wie der frische Wind sanft durch mein Haar streicht. Der Sommer kündigt sich an, überall ist er zu riechen und im Konzert der vielen Vögel zu hören. Ein Gefühl der Geborgenheit überkommt mich, als ich den vertrauten Weg von der Bushaltestelle nach Hause gehe.
Die Haustür steht einen Spalt offen, als würde sie mich schon erwarten. Im Türrahmen erscheint meine Mutter mit einem warmen, zärtlichen Lächeln.
»Lucia, da bist du ja!«, ruft sie und ihre Stimme klingt wie eine Melodie in meinem Kopf. Sie streicht mir mit dem Daumen über die Wange und drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Das Gefühl erzeugt einen wohligen Schauer bei mir.
Ich trete ein, lasse meinen Schulrucksack an der Garderobe zu Boden fallen und schlüpfe aus meinen Schuhen. Die vertraute Geräuschkulisse erfüllt das Haus - das Knarren der Holzdielen, wenn mein kleiner Bruder oben herumtobt und das Motorengeräusch des Düsenjets nachahmt, mit dem er gerade spielt.
»Beeil dich, Fabio«, ruft Mama nach oben, in ihrer Stimme schwingt eine Mischung aus Zärtlichkeit und Ungeduld. »Wir müssen gleich los, sonst kommen wir zu spät.«
Die Worte erinnern mich daran, dass meine Mutter noch einen Termin in der Stadt hat. Mein Vater und mein Bruder wollen mitfahren, um Schuhe für Fabio zu kaufen. Er ist aus den aktuellen herausgewachsen.
Mein Vater sitzt am Tisch, die Zeitung vor sich ausgebreitet, eine dampfende Tasse Kaffee in der Hand. Er blickt auf und sein Gesicht wird von einem Lächeln erhellt, das sich warm in meiner Brust ausbreitet.
»Hallo, Schatz«, begrüßt er mich. Seine Augen sind voller Stolz und Liebe - Emotionen, die ich so schmerzlich vermisse.
Es ist ein gewöhnlicher Tag. Ein Tag wie jeder andere und gleichzeitig einer der schrecklichsten meines Lebens. Die Atmosphäre ist von einer heiteren Gelassenheit durchdrungen - jeder von uns ist in seine tägliche Routine versunken. Ich höre das Lachen meines kleinen Bruders, höre, wie meine Mutter ihn wieder zur Eile ermahnt, sehe, wie mein Vater über diesen wenig erfolgversprechenden Versuch lächelt - alles erscheint mir so real, dass ich fast vergesse ...
... dass es nur ein Traum ist.

Als ich an diesem Morgen aufwache, brauche ich nicht auf den Kalender zu schauen, um das Datum zu wissen. Der Traum hat es mir bereits verraten.
10 Jahre sind seit dem Tage vergangen, an dem das Schrecklichste geschah, was man sich vorstellen kann. Es ist 10 Jahre her, dass ich meine Familie verloren habe. Und seit 10 Jahren habe ich in der Nacht davor immer den gleichen Traum. Einen Traum, der sich genau so abgespielt hat. Es sind die letzten Stunden, die ich gemeinsam mit meiner Familie verbracht habe.
In all den Jahren habe ich mich immer wieder gefragt: Hätte ich etwas anders machen können? Hätte ich es verhindern können? Wäre es ihnen genauso ergangen, wenn sie später losgefahren wären? Wenn ich mit ihnen gegangen wäre? Wenn ich meinen Vater überredet hätte, an einem anderen Tag zu fahren? Hätte ich dann wenigstens seinen und Fabios Tod verhindern können?
Gerade am Anfang waren diese Gedanken sehr präsent, aber mit der Zeit verblassten sie. Egal, welches Szenario ich durchspiele, Tatsache ist, dass sie nicht mehr da sind. Dass ich sie verloren habe.
Ich beginne den Tag, wie ich ihn immer beginne. Ich ziehe mich an, frühstücke etwas. Alles läuft automatisch und routiniert ab. Dann gehe ich auf den Markt und kaufe Blumen. Um genau zu sein, nur eine einzige Blume - eine gelbe Tulpe, die ich später auf dem Weg nach Hause in den Fluss werfen werde - als stummen Gruß. Derselbe Fluss, der durch meine Heimatstadt fließt. Tulpen waren die Lieblingsblumen meiner Mutter. Sie war jedes Jahr im Frühling voller Vorfreude, wenn wieder Tulpenzeit war. Und am liebsten hatte sie die leuchtend gelben. Wenn meine Heimatstadt nicht so weit weg wäre, würde ich sie ihr auf das Grab legen. Der Fluss ist ein Kompromiss, denn irgendwann wird die Tulpe auch in der Nähe meiner Mutter vorbeischwimmen.
Mit der Tulpe in der Hand fahre ich ein paar Stationen mit der U-Bahn und gehe durch die Straßen bis zum Dom. Ich bin kein gläubiger Mensch. Religion und Gott haben in meiner Familie nie eine Rolle gespielt. Was für eine Ironie des Schicksals.
Aber nachdem meine Familie nicht mehr da war und ich auch von meiner verbliebenen Familie keine Unterstützung bekam, habe ich in der Kirche ein wenig Trost gefunden. Nicht spirituell, sondern einfach, weil ich einen Ort hatte, an dem ich sein konnte. Wo ich meinen Gedanken nachhängen konnte, wo mich niemand für meine Tränen verurteilte. Manchmal hat sich der alte Pfarrer zu mir gesetzt und wir haben über alles Mögliche geredet. Ich konnte nie von meiner Familie erzählen, die Worte brachte ich nicht über mich. Aber ich bin sicher, er wusste genau, wer ich war. Das arme Mädchen, das seine Familie bei diesem tragischen Ereignis verloren hatte. Aber er sprach mich nie direkt darauf an, wofür ich ihm sehr dankbar war.
Nach meinem Umzug in die Großstadt verlor ich diese Möglichkeit. Die Entfernung zu meiner Heimat ist zu groß, so dass ich auch den Friedhof, auf dem meine Familie ruht, nicht besuchen kann. Der Dom ist eine gute Alternative, auch wenn er viel anonymer ist. Aber er erfüllt seinen Zweck. Ich setze mich auf eine der Bänke, beobachte die Menschen, die das Bauwerk und seine Kunst bewundern, und lasse meinen Gedanken freien Lauf. Normalerweise hilft mir das, den Tag irgendwie zu überstehen.
Aber heute ist etwas anders. Heute ist die Sehnsucht nach meiner Familie besonders groß. Da hilft es auch nicht, dass ich noch eine Stunde länger im Dom sitze und mir dann, nachdem ich der Tulpe eine gefühlte Ewigkeit nachgeschaut habe, mein Lieblingseis gönne.
Als ich die WG betrete, ist meine Stimmung im Keller. Ich will einfach nur meine Ruhe haben, mich mit einem Tee in meinem Zimmer verkriechen und die Decke über den Kopf ziehen. Ich verfluche mich dafür, dass ich heute keinen Urlaub beantragt habe und nachher zur Arbeit muss.
Leider bin ich nicht allein und genau in dem Moment, in dem mir wieder die Tränen über die Wangen zu laufen drohen, kommt mein Mitbewohner in die Küche.
Seit unserem Streit vor etwa einer Woche ist die Stimmung zwischen uns angespannt und ich möchte nicht, dass er mich so sieht. Schnell drehe ich ihm den Rücken zu, doch Felix scheint sofort zu spüren, dass etwas nicht stimmt. Ruhig tritt er neben mich, mustert mich von der Seite, sagt aber zunächst kein Wort. Er nimmt mir die Tasse, in der ich gerade Tee zubereiten wollte, aus der Hand. Das ist wohl auch besser so, denn erst jetzt fällt mir auf, wie sehr meine Finger zittern. Verflucht!
»Musst du heute arbeiten?«
Ich nicke und schniefe. Wische mir mit dem Ärmel hastig die Tränen weg.
Er gießt kochendes Wasser in die Tasse und verschwindet aus der Küche. Kurz darauf kommt er zurück und hält mein Handy in der Hand. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich es den ganzen Tag gar nicht dabei hatte.
»Du solltest dich krankmelden.«
»Das geht nicht«, antworte ich mit brüchiger Stimme. »Hannah rechnet mit mir, es gibt viel zu tun.«
Er verschränkt die Arme vor der breiten Brust, lehnt lässig mit der Hüfte an der Küchenzeile und schaut auf mich herab, während ich mich unter seinem durchdringenden Blick hilflos fühle. Eigentlich weiß ich, dass er recht hat. So wie meine Finger zittern, würde ich wahrscheinlich jedes zweite Glas fallen lassen. Aber die Arbeit lenkt mich ab und bringt mich auf andere Gedanken. Zu Hause zu bleiben, würde mich nur noch tiefer in das dunkle Loch ziehen, an dessen Rand ich mich gerade befinde.
Felix dreht mein Handy in seiner großen Hand hin und her. »Okay, ich mache dir einen Vorschlag: Du meldest dich krank und wir machen uns einen schönen Tag. Wir verkriechen uns hier in der WG - nur wir zwei. Ich habe neulich eine tolle Serie gefunden. Sechs Staffeln, das sollte uns beschäftigen. Dazu bestellen wir uns Pizza. Was meinst du?« Seine Stimme klingt warm und einladend.
Als ich immer noch nicht antworte, hält er mir auffordernd das Handy hin, als wolle er mir die Entscheidung erleichtern. Ich ringe noch einen Moment mit mir, dann gebe ich nach, nehme es ihm ab und entsperre es mit einem Fingerwisch. Hannahs Nummer ist schnell gewählt und sie meldet sich sofort. Ihre Stimme ist voller Verständnis und sie wünscht mir gute Besserung.
Als ich das Handy wieder sperren will, fallen mir noch die vielen ungelesenen Nachrichten und Anrufe von Tino auf. Mein schlechtes Gewissen meldet sich. Wir haben seit drei Woche fast täglich Kontakt. Vielleicht hätte ich ihn vorwarnen sollen, damit er sich keine Sorgen macht, weil ich mich nicht melde. Aber ich schiebe den Gedanken vorerst beiseite. Ich habe im Moment keine Kraft, mich damit zu beschäftigen und beschließe, ihm später ausführlich zu antworten, wenn es mir besser geht.
Felix nickt zufrieden, als ich mich wieder zu ihm umdrehe. Er lächelt und drückt mir den fertigen Tee in die Hand.
»Hier, geh in mein Zimmer und mach es dir gemütlich. Ich bereite noch etwas vor.«
Keine Frage, was mit mir los ist, was der Grund für meine Stimmung ist. Er nimmt es einfach hin und hilft mir. Ich sollte mich wundern, aber im Grunde bin ich nur froh, weil ich ihm nichts erklären muss. Dass er einfach akzeptiert, dass es mir schlecht geht.
Nachdem ich meine Wolldecke und mein Lieblingskissen aus meinem Zimmer geholt habe, machen wir es uns in seinem Bett bequem, das viel größer und zugegebenermaßen auch viel bequemer ist als meines. Er stellt Getränke und Snacks auf einen kleinen Tisch und schaltet den überdimensionalen Fernseher an der Wand ein. Und dann schauen wir Lucifer. Im Grunde ist es mir völlig egal, es hätte auch die Lindenstraße sein können. Obwohl ich zugeben muss, dass ich verstehe, warum er die Serie so mag. Irgendwie haben Lucifer und er einen sehr ähnlichen Humor.
Wir blenden die Welt um uns herum komplett aus, sprechen kaum miteinander und konzentrieren uns ganz auf die Serie. Felix gibt immer wieder Kommentare zu den Geschehnissen auf dem Bildschirm von sich und bringt mich ein ums andere Mal zum Lachen. Zwischendurch bestellt er Pizza, die wir in seinem Bett genießen. Irgendwann legt er einen Arm um meine Schultern und zieht mich sanft an sich. Dankbar lege ich meinen Kopf auf seine breite Brust und gebe mich ganz der Wärme und Geborgenheit hin, die sein Körper ausstrahlt. Ich habe das Gefühl, in einem sicheren Hafen vor Anker zu liegen, geschützt vor den stürmischen Wellen des Tages.
Und irgendwann, als Detective Decker die Wahrheit über Lucifer Morningstar erfährt, übermannt mich die Müdigkeit. Meine Augenlider werden schwer wie Blei, und schließlich gleite ich in einen tiefen, ruhigen Schlaf, begleitet von den sanften Klängen des Fernsehers und dem gleichmäßigen Rhythmus seines Atems.
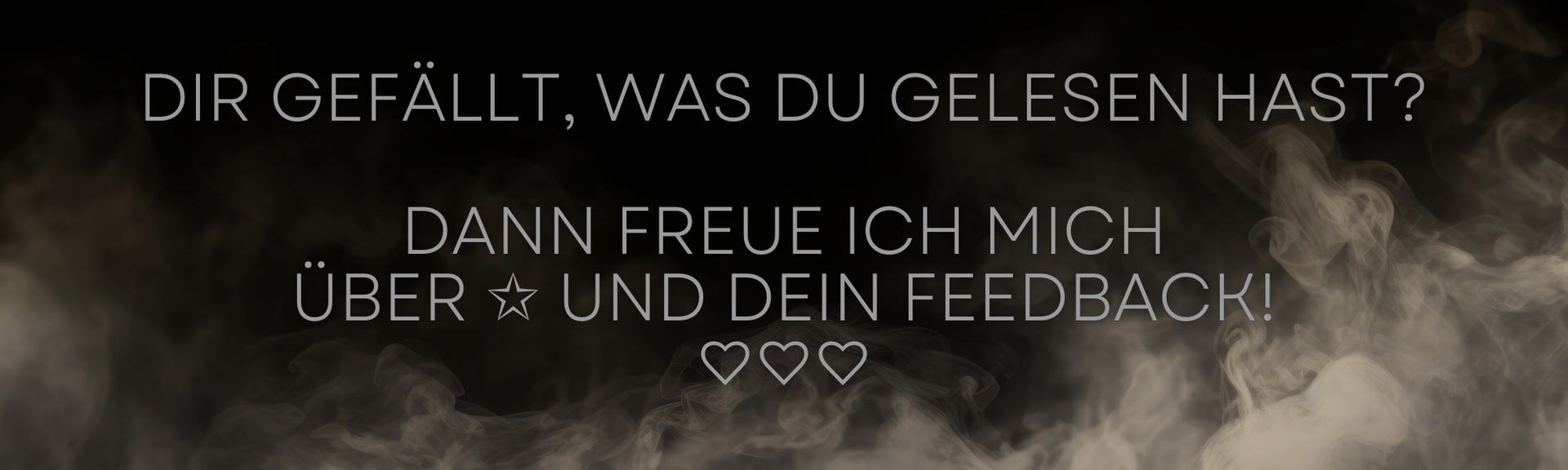
⫸ 22.702 Wörter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro