V I E R Z E H N
Als ich später in dieser Nacht wieder in meinem Bett liege, fühle ich mich erstaunlicherweise sehr viel besser, als davor. Martins Gesellschaft hat mich wirklich entspannt, vor allem die Art und Weise, wie er mit allem so offen und ehrlich umzugehen scheint. Schätze, an der Redewendung ›Gegensätze ziehen sich an‹ dürfte was dran denn. Auch, wenn ich immer noch auf der Hut bin, da das einfach in meiner Natur liegt, würde ich so weit gehen zu behaupten, dass er ein Freund ist.
Als wir uns verabschiedet hatten, habe ich vorgeschlagen, ihn am nächsten Tag von seinem krankhaften Arbeitszwang zu erlösen und auf einen ranzigen Burger bei Gladys einzuladen. Ist nun wirklich nicht so, dass ich etwas besseres vorhätte und langsam fange ich an, mich in des holden, rechtschaffenen Doktors Gegenwart wohlfühlen. Dass er sich nicht so leicht von dieser Schicht aus Stacheldraht und Schmirgelpapier um mein Herz abschrecken lässt, ist natürlich noch ein weiterer Pluspunkt.
Das Einzige, worauf ich im Hinblick auf ihn verzichten könnte, sind diese mitleidigen Blicke, die er mir manchmal zuwirft, wenn er denkt, ich sehe es nicht. Ich weiß, dass es nicht böse gemeint ist, aber trotzdem... ich will das nicht.
Als ich also in dieser Nacht in meinem Bett liege und langsam weg drifte, denke ich keine Sekunde an das desaströse und überaus merkwürdige Abendessen mit dem Bürgermeister Stunden zuvor. Doch leider soll ich im Schlaf nicht so viel Glück haben.
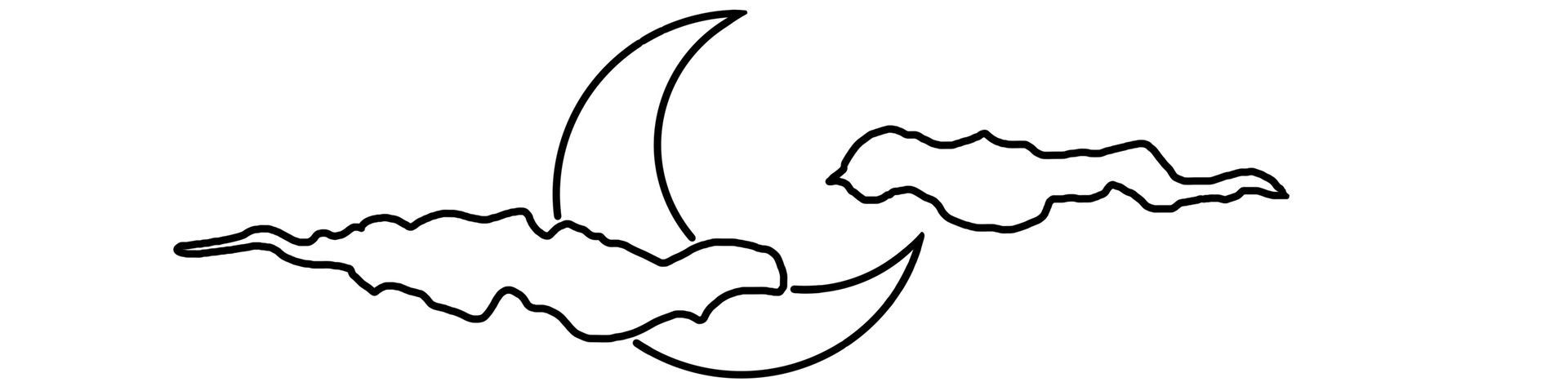
Ein Tisch aus Eisen. Ein harter Stuhl, auf dem ich sitze. Und Bürgermeister O'Connor, der mich, über den Tisch gebeugt, ernst taxiert.
»Miss Cunnings, Sie wissen ganz genau, was zu tun ist. Spielen Sie nicht mit mir.«
»Was reden Sie da überhaupt, Sie Schnösel? Ich habe rein gar nichts getan!«
O'Connor widerspricht mir nicht. Mit diesen harten Augen, die mich einzusaugen scheinen, wie zwei schwarze Löcher, sieht er mich lediglich weiter an. Kein Wort verlässt seine Lippen. Er ist eine Statue, ich bin eine. Zumindest fühle ich mich so.
Schließlich löst er sich aus seiner Starre und richtet sich auf. Er dreht sich langsam zur Seite und legt den Kopf in den Nacken, die Deckenleuchte direkt über seinem Gesicht. Das harte Licht betont seine Wangenknochen noch stärker und lässt ihn für einen Augenblick nicht einmal mehr menschlich wirken. Er sieht aus wie ein Dämon.
Er kramt in seiner Hosentasche und fördert diese Taschenuhr zutage, die ich bereits beim Dinner an ihm gesehen habe. Mit einem Knopfdruck springt der Deckel auf. Was auch immer Hayes O'Connor in ihr sieht, scheint ihn nicht zu erfreuen. Seine Kieferpartie verhärtet sich und er fährt sich in einer schnellen, fließenden Bewegung übers Gesicht. Dann sieht er mich wieder an.
»Sie müssen es jetzt tun.«
Verdutzt blinzelnd schnauze ich: »Wovon zur Hölle reden Sie da bitte?!« Dass sich in seiner sonst so ungerührten Miene jetzt tatsächlich etwas, das man als Sorge auslegen könnte, abzeichnet, beunruhigt mich.
Er kommt zu mir, fasst mich bei den Schultern und zieht mich hoch. Sein zitroniger, herber Geruch steigt mir in die Nase, als er plötzlich seine Wange an meine legt. Sein Dreitagebart kratzt mir leicht über die Haut, als er flüstert: »Töte mich, Uma.«
Auf einmal halte ich etwas kaltes in Händen und O'Connor löst sich ein Stück von mir. Er legt seine Hand um meine und hebt sie hoch. Mit Schrecken erkenne ich, dass ich einen Dolch umklammere. Er ist schneeweiß und so hell, dass es fast wehtut, ihn anzusehen.
»Töte mich!«, wiederholt er, diesmal lauter und energischer, sein irischer Akzent klingt noch härter durch. Seine Hände dirigieren meine und setzen die glänzende Spitze an seiner Brust an, welche in einem cremefarbenen Hemd steckt. Direkt über dem Herzen übt er langsam Druck aus, immer mehr und mehr. Der makellose Stoff beginnt, sich in einem immer größer werdenden Kreis rot zu färben. Ich will mich von ihm losreißen und rennen, einfach nur wegrennen, doch da wird sein Griff um meine Hände schrabstockartig fest und er stößt mit einem Ruck zu...
Ich zucke so heftig zusammen, dass ich über die Bettkante fliege. Der Schock – sowohl über den Albtraum, als auch den Sturz von der Matratze – sitzt mir immer noch in den Knochen, als ich mich schmerzverzerrt grummelnd aufrappele. Verflucht seist du, Hayes O'Connor!
Die Aussicht auf das Treffen mit dem Doktor später stimmt mich allerdings etwas milde. Ich habe keine Ahnung, was dieser bekloppte Albtraum sollte, verspüre aber herzlich wenig Lust, dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Doch leider will mir für die nächsten Stunden einfach nicht aus dem Kopf gehen, wie sich das spitze Metall in O'Connors Brust vergaben hat. Ob ich am Frühstückstisch sitze, draußen spaziere oder lese – ich kann es einfach nicht vergessen.
Aber ehrlich gesagt ist mir dieses grausige Bild sogar fast lieber, als sein angewiderter Gesichtsausdruck, als ich mich gestern Abend auf der Veranda praktisch an ihn heran geschmissen habe, um (Informationen welcher Art auch immer) aus ihm rauszubekommen. Die Aktion war einfach nur stillos und blöd. In meinem bisherigen Leben war ich weder das Eine, noch das Andere, also werde ich jetzt gewiss nicht damit anfangen.
Ein Blick auf das Display meines Handys sagt mir, dass der Doc in zwanzig Minuten Feierabend hat. Eigentlich wollten wir uns bei Gladys' Tankstelle treffen, aber er wird sicher nichts dagegen haben, wenn ich ihn vom Krankenhaus abhole.
Dort angekommen bitte ich die Frau an der Rezeption – es ist eine andere, als beim letzten Mal – Bold Bescheid zu geben, dass ich auf ihn warte. Sie nickt und sagt: »Wenn Sie mir kurz Ihren Ausweis zeigen würden.« Perplex gehe ich ihrer Bitte nach. Die Frau wirft einen kurzen Blick darauf, dann nickt sie lächelnd. »Alles klar, der Doktor hat der Rezeption schon mitgeteilt, dass Sie eine Freundin sind. Den Ausweis musste ich sehen, bevor ich Ihnen private Informationen geben kann.« Wow, scheint, als würden die hier einen riesen Geschiss um ihn und seine Privatsphäre machen.
Die Rezeptionistin schaut in ihrem Computer nach, dann gibt sie mir folgende Auskunft: »Derzeit befindet er sich in einer Operation mit leichten Komplikationen, das kann also noch etwas dauern. Nehmen Sie doch so lange im Wartebereich am Eingang Platz.« Enttäuscht verziehe ich den Mund und bedanke mich knapp, dann mache ich mich auf den Weg dorthin.
Genervt lasse ich mich auf einem der hässlichen, gepolsterten Hartschalen-Stühle fallen und observiere die Umgebung – was anderes, als dumm in der Gegen rum zu schauen, gibt es hier ja nicht zu tun. Die mit was auch immer verseuchten Zeitschriften rühre ich ganz sicher nicht an, so viel steht fest.
Ich habe die Zeit komplett aus den Augen verloren, als die alte Dame neben mir irgendwann aufsteht und ein Ehepaar mittleren Alters sich auf ihren Platz setzt. Es sieht stark danach aus, dass Martin noch eine ganze Weile im OP sein wird, weshalb ich schon drauf und dran bin, zu gehen. Doch das in Flüsterton geführte Gespräch neben mir lässt mich inne halten.
»Er sagte, er holt uns direkt ab«, murmelt der Mann und sein Tonfall ist längst nicht mehr gestresst. Er wirkt, als wäre der Teufel hinter ihm her. ›Gehetzt‹ ist gar kein Ausdruck.
Misstrauen macht sich in mir breit, wovon ich mir nichts anmerken lassen will. Möglichst unbeteiligt verschränke ich die Arme, lehne mich zurück und lasse das Kinn auf die Brust sinken, als würde ich dösen.
»Keine Sorge, Schatz, das wird schon. Diesmal ganz bestimmt.«
»Wir haben schon so viele Enttäuschungen erlebt... du hast so viele erlebt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn –«
»Liebling! Bitte, bleib ganz ruhig. Das wird schon!«
Dann sagt sie noch etwas, das ich nicht ganz verstehen kann, weil es zu leise ausgesprochen wird. Aber es klang sehr verdächtig nach ›Keiner wird je davon erfahren‹. Trotzdem gut möglich, dass ich mich geirrt habe und die beiden nichts Merkwürdiges im Schilde führen. Mein Instinkt ist zwar gut, aber nicht unfehlbar.
Doch bei den folgenden Worten des Mannes, verflüchtigt sich jeder meiner Zweifel an besagtem Instinkt. »Mir ist das hier nicht geheuer, Tara. Ich meine, allein die Tatsache, dass wir niemandem was sagen dürfen, und dass es im Keller stattfindet, ist –«
»George! Bitte... alles wird gut. Vertrau mir.«
»Dir vertraue ich doch, nur denen nicht!«, zischt er jetzt.
Doch bevor das Gespräch noch weiter eskalieren kann, werden sie von einer ruhigen und souveränen Stimme unterbrochen, die mir sehr bekannt ist: »Misses Fallons? Doctor Wallace erwartet Sie bereits in seinem Sprechzimmer, ich bringe Sie beide hin.« Dann fällt Martins Blick auf mich und seine Miene erhellt sich. Das paar geht voraus und er formt mit den Lippen ›Bin gleich da‹, woraufhin ich nicke.
Während ich ihnen hinterher sehe, will dieses komische Gefühl einfach nicht verschwinden. Fast kommt es mir so vor, als wäre da irgendetwas faul.
Etwa eine Viertelstunde später steht Martin schließlich vor mir. Den weißen Kittel hat er durch sein übliches Outfit aus verwaschener Jeans, T-Shirt und Windjacke ausgetauscht. »Na, wollen wir los?« Ich erwiderte sein Grinsen mit einem kleinen Lächeln – Strahlen, als würde mir die Sonne aus dem Arsch scheinen, ist einfach nicht mein Ding. Aber ihm steht es.
Da der Fußweg zur Tankstelle nicht allzu lang ist, laufen wir. Während der ersten Paar Minuten redet keiner von uns. Ich finde es gut, dass Martin kein Gespräch zwischen uns erzwingen will, wie die meisten Menschen, die Stille einfach nicht ertragen können und sich dann krampfhaft an Smalltalk festklammern, wie an einen Rettungsring.
Schließlich bin ich diejenige, die anfängt zu reden und spreche das aus, was mir schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt: »Was waren das für Menschen?«
Etwas irritiert blickt Martin mich von der Seite an. »Meinst du das Paar von eben?« Ich nicke wortlos, woraufhin er ratlos die Schultern zuckt. »Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung.«
»Sie haben davon gesprochen, dass sie Stillschweigen über irgendwas bewahren müssen und den Termin im Keller haben, oder so ähnlich.« Ich weiß es nicht, ob es so klug ist, ihm das alles so offen zu erzählen. Aber überrascht muss ich feststellen, dass ich ihm vertraue. Und als Martin mir in die Augen schaut, fühle ich mich in meiner Annahme bestätigt. Ich kann nichts als aufrichtige Verwirrung in seiner Miene verzeichnen.
»Bist du dir sicher, dass du das richtig verstanden hast? Ich wüsste wirklich nicht, warum Doktor Wallace irgendwelche Patienten im Keller behandeln sollte. Und was das Stillschweigen angeht, fällt mir auch absolut nichts dazu ein.« Martin runzelt die Stirn und legt nachdenklich die Hand an sein Kinn.
»Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich alles richtig verstanden habe, aber... möglich, dass sie eigentlich über irgendwas anderes gesprochen haben.« So wirklich glaube ich selbst zwar nicht an diese Variante, aber es kann eben immer sein, dass man sich täuscht.
Martin schreckt aus seinen Gedankengängen hoch und sieht mich an. »Weißt du was, Uma? Ich werde mich mal unauffällig umhören. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas Komisches im Krankenhaus passiert, wenn du mich fragst.« Ich nicke lediglich und damit ist das Thema fürs Erste erledigt. Den Rest des Weges unterhalten wir uns über komplett andere Dinge – Alles und Nichts, wie man so schön sagt.
Doch aus irgendeinem Grund will sich dieses merkwürdige Gefühl in meinem Nacken einfach nicht verflüchtigen.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Damn, da ist doch was im Busch... irgendwelche Vermutungen? 👀
Grüße,
Cady
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro