(2/1) Donegal Airport
Liebe Holly!
Ich möchte mich für das wunderbare Bild bedanken, das Du mir gemalt hast. Es ist toll geworden! Deine Mama schrieb mir, Du hättest mir das Haus gemalt, damit ich ein Zuhause habe... weil es nicht geklappt hat, dass ich zu euch kommen kann. Das war sehr lieb von dir! Natürlich kann man in einem gemalten Haus nicht wohnen, aber es scheint mir auf jeden Fall Glück zu bringen. Ich habe nämlich eine andere Stelle gefunden! Deine Mama wird Dir diesen Brief vorlesen, sie freut sich ganz sicher ebenfalls darüber.
Die Familie, bei der ich arbeiten werde, lebt nicht in England, sondern in Irland. Das Meer soll ganz in der Nähe sein und ich musste mit dem Flugzeug hinfliegen. Jetzt sitze ich gerade am Flughafen in Irland und warte auf die Familie, die mich gleich abholen wird. Ich bin schon zweimal geflogen, aber das letzte Mal ist mehr als drei Jahre her, darum war ich vorhin ziemlich aufgeregt. Als ich aus dem Fenster sah, war England weit unten und ganz klein und ich konnte einen wahnsinnig schönen Sonnenuntergang sehen. Die Wolken waren von unten her orange und rot angestrahlt von der Sonne. Und als sie weg war, als es dunkel wurde und wir über Irland flogen, gingen unten die ganzen Lichter an. Vor der Landung flogen wir tiefer, da konnte man das Licht in den kleinen Häusern überall aufleuchten sehen. Das sah sehr schön aus.
Ich hoffe, Dir und Deinem Bruder geht es gut! Auch wenn es noch ein wenig hin ist, wünsche ich euch beiden schon einmal ganz tolle Weihnachtstage. Sag doch Jasper bitte, wie sehr ich mich auch über seine Zeichnung von der Ritterburg und dem Schwert unter eurem Brief gefreut habe. Mit unserem Ritterspiel ist es ja nun leider nichts geworden. Ganz sicher werdet ihr aber ein anderes Kindermädchen finden, das mit euch spielt und hoffentlich viele gute Ideen hat!
Ich bin schon sehr gespannt, wie mir die Arbeit bei der neuen Familie gefallen wird, wo sie wohnen und wie es da so ist. Vielleicht male ich Dir ja ein Bild von dem Haus, in dem ich arbeiten werde und schicke es Dir! Eure Adresse habe ich ja.
Ich muss nun meine Schreibsachen einpacken, denn ich werde gleich abgeholt. Grüß bitte Jasper und Deine Mama von mir. Und liebe Grüße auch an die Oma!
Emma

Den letzten Satz hatte sie wieder streichen wollen, gleich nachdem sie ihn geschrieben hatte. Aber das hätte unschön ausgesehen. Auch war keine Zeit, den Brief neu zu schreiben. Tante Moni hatte einmal gesagt, man sollte zu den Leuten, die schlecht über einen dachten, immer ganz besonders freundlich sein. Nicht, damit sie ihre Meinung änderten, sondern damit sie über sich selbst nachdachten.
Seufzend steckte Emma den Kugelschreiber in ihre Tasche zurück. Noch einmal überflog sie den Brief, dann riss sie ihn vorsichtig aus der zerfledderten Kladde heraus - so gut es eben auf den Knien und bei dem diffusen Licht ging. Sie faltete ihn zweimal.
Eigentlich sollte der Brief längst geschrieben und abgeschickt sein, aber sie hatte es vorher nicht mehr geschafft. Wenn sie ehrlich war, wusste sie, was das Problem war. Es war das Haus. Hollys Bild. Die Ähnlichkeit des Hauses, ja, sogar des Brunnens und der Anordnung der Bäume ringsum mit der Szenerie aus ihrem Traum war irritierend. So sehr, dass sie versucht gewesen war, auf den Brief der Familie Chapman gar nicht mehr zu antworten und es dabei zu belassen. Aber das wäre unhöflich gewesen. Und es hätte ihr leid getan wegen der Kinder. Holly und Jasper hatten eine freundliche Reaktion auf ihr Bild verdient.
Irgendwo musste der Umschlag sein, sie hatte ihn gestern Nacht extra noch vorbereitet. Nachdem sie das chaotische Innenleben ihrer Tasche zweimal vergeblich durchwühlt hatte, fand sie das Couvert schließlich in dem schmalen Eingriff an der Innenseite der Klappe. Sie fischte es heraus und schob den Brief hinein. Einen Moment zögerte sie; dann drückte sie die selbstklebende Lasche zu. Vorne am Ausgang gab es einen Briefkasten, dort konnte sie ihn gleich einwerfen.
Müde ließ sie sich in die bequeme Sitzschale fallen und drückte den Rücken in die ausgebuchtete Lehne. Es tat gut, einen bequemen Stuhl unter sich zu haben, die Sitze im Flugzeug waren eine Katastrophe gewesen. Das durchgehende Gestell, an dem die Reihe der Plätze montiert war, gab ein wenig nach, als sie sich zurück lehnte. Sie streckte die Beine durch und hob eines an, tippte mit der Schuhspitze gegen ihren roten Koffer. Den Brief behielt sie in der Hand, sie durfte ihn gleich nicht vergessen. Es war gut ihn noch los zu werden, bevor sie in ihr neues Leben trat. Bei den Chapmans wäre es schön gewesen... aber wer wusste schon, wozu es gut war, wenn Dinge, die man sich gewünscht hatte, doch nicht real wurden.

Einige Meter vor ihr befand sich eine große Scheibe. Während sie mit dem Schreiben beschäftigt gewesen war, musste es zu regnen begonnen haben. Zuerst hatte sie den Wartebereich ganz für sich allein gehabt; vertieft in ihre Gedanken war ihr aber entgangen, dass ein Mann dort hinten an der Säule stand und hinaus schaute. Das dunkle Leder seines Mantels glänzte nass an Schulter und Ärmel. Irgendwo in der Sesselreihe hinter ihr wurden die Stimmen einer Frau und eines Kindes hörbar, aber sie drehte sich nicht um.
Sie starrte in die Dunkelheit jenseits des kalt beleuchteten Rollfeldes. Bald wurde ihr Blick von den Tropfen auf der Scheibe abgelenkt, das Licht fing sich darin. Es wurden schnell mehr, die Tropfen wurden größer und dichter. Sie verschmolzen miteinander, bildeten feine, gezackte Ströme, die aus sich heraus zu leuchten schienen; wie flüssiges Silber liefen sie der unteren Kante der Scheibe entgegen und verschwanden.
Draußen wurde es heller, man hatte das Licht auf dem Platz eine Stufe höher geschaltet. Eine kleine Maschine rollte in ihr Sichtfeld hinein und hielt an. Der Mann mit dem Ledermantel trat zurück und verschwand irgendwo im hinteren Teil des Raumes. Aus der Unruhe in ihrem Rücken schloss Emma, dass sich der Wartebereich mit Menschen zu füllen begann. Das wirre Netz aus Tropfen und Strömen auf der Scheibe verstärkte das einfallende Licht. Sie blinzelte müde, sah auf die große Uhr an der Seitenwand. Zwanzig nach Sieben... Um halb Acht würde man sie abholen. Frühestens, hieß es, denn es war damit zu rechnen, dass man nicht pünktlich sein konnte. In diesem Fall sollte sie warten und sich keine Gedanken machen, das hatte Grace ihr geschrieben. Und dass sie sie gegen Ende der zweiten Woche besuchen wollte, damit sie einander persönlich kennenlernen konnten. Zwei Wochen... bei den Saunders hätte sich das wie eine Ewigkeit angefühlt.
Erst jetzt, als die Begegnung mit der neuen Familie näher rückte, wurde ihr bewusst, warum sie sich bereits den ganzen Tag lang so eigenartig fühlte. Wenn sie das letzte kurze Telefongespräch mit Ms. Potts am Morgen und die knappe Verabschiedung von den Saunders nicht zählte, hatte sie heute buchstäblich mit niemandem gesprochen. Unwillkürlich räusperte sie sich, um sicher zu gehen, dass ihre Stimme noch da war. Aber das war es nicht. Was sie ins Grübeln brachte, war die Tatsache, dass sie diese gleichförmige Ruhe in sich spürte. Sie hatte keine Angst. Da war buchstäblich keine Aufregung der Art, die doch so typisch für sie gewesen wäre. Insbesondere nach den Erfahrungen mit ihrer letzten Gastfamilie hätte sie jetzt doch irgendetwas befürchten, hoffen oder erwarten müssen. Das wäre nachvollziehbar gewesen. Es war doch aufregend und spannend, wenn man eine AuPair Stelle verließ, um eine neue anzunehmen. Bei Leuten, die man nicht kannte. In einem Land, in dem man noch niemals war.
Es war seltsam. Sie war wie fremdgesteuert, wie betäubt, seit heute Morgen schon. Als ob sie nicht wirklich da war. Alles, was sie noch hatte erledigen müssen, war auf mechanische Weise und ohne großartig nachzudenken geschehen, ihre Hände hatten wie von selbst alles, was ihr gehörte, aus dem Schrank und vom Sessel genommen und in den Koffer gepackt. Wie ein Roboter hatte sie im Bad ihre Sachen geortet und alles ins Zimmer getragen, dann das Bett abgezogen, die Bettwäsche zusammen mit den gebrauchten Handtüchern zur Waschmaschine in den Keller gebracht und sogar noch eine Waschladung angestellt und später alles in den Trockner getan. Sie hatte sich am Nachmittag systematisch, knapp und schlicht von allen, die anwesend waren, verabschiedet und war dann mit Koffer und Handgepäck die Einfahrt hinunter und zur Bushaltestelle gegangen.
Vielleicht hätte Stephen sie zum Flughafen gebracht, aber er war nach dem Mittag wieder in die Uni gefahren. Vielleicht hätte sie aber auch abgelehnt, wenn er es angeboten hätte. Irgendwie war es ihr wichtig gewesen, auf eigenen Füßen und aus eigener Kraft dort weg zu kommen. Als ob sie den Weg selbst gehen musste, um ihn glauben zu können. Das war ihr eigenartig verdrehter Trotzkopf, es war typisch für sie. Immer schon hatte sie lange gebraucht, bis sie in Gang kam, ein Problem anpackte und eine Entscheidung traf; aber wenn sie dann endlich klar mit sich selbst war, legte sie großen Wert darauf, die Schritte, auf die es ankam, selbst zu tun.
Es war möglich, dass sie viele ihrer Erfahrungen bei den Saunders noch gar nicht verarbeitet hatte. Bestimmt würde ihr erst mit entsprechender Distanz zu den vergangenen drei Monaten aufgehen, wie schrecklich es tatsächlich gewesen war.

Was also sollte sie jetzt denken oder fühlen, wo sie hier saß und wartete? Froh konnte sie erst sein, wenn sich zeigte, dass sie es nun besser getroffen hatte. Und das würde sich ganz bestimmt nicht an einem ersten Abend zeigen, das hatte sie inzwischen gelernt. Auch die Saunders waren ihr in den ersten beiden Tagen nett genug erschienen - und was ihr unbehaglich war, was sie bereits auf Anhieb nicht mochte, hatte sie auf die obligatorischen Anfangsschwierigkeiten geschoben. Schließlich hatte sie sich noch nicht eingelebt. Was sie daraus gelernt hatte: dass Situationen und Leute, die sich zunächst entspannt und positiv zeigten, zum Drama werden konnten. Und dass Leute, die einem auf den ersten Blick versnobt und arrogant erschienen, manchmal ausgerechnet diejenigen waren, die sich später als verständig und hilfsbereit erwiesen. Stephen war so ein Fall. Wenn er nicht ab und zu gefragt hätte, wie es ihr ging - wenn er nicht aufmerksam gewesen wäre, nicht manche Situation für sie entschärft und glatt gebügelt hätte - sie wäre an dieser Familie schon viel früher verzweifelt. Und vor allem hätte sie sich selbst mehr Schuld zugewiesen als ihr gut getan hätte. Stephen hatte mit seiner trockenen, vermittelnden Art verhindert, dass sie an ihren Selbstzweifeln unterging. Er hatte ihr in diesen Wochen oft Recht gegeben und das hatte ihr geholfen, ihrer Wahrnehmung zu vertrauen.
Wie es nun bei den Ò Briains sein würde, wer konnte das sagen! Auf keinen Fall wollte sie den Fehler begehen, sich hier nun vorzeitig Sorgen zu machen. Aber sie wollte auch nicht zu euphorisch sein. Dass diese neue Stelle ihre unglückliche Zeit in London beendete, war wunderbar. Sie war sehr dankbar dafür. Aber auch andere Stellen konnten problematisch werden. Familien konnten schwierig sein. Und Kinder! Und sie war auch nicht deshalb so weit weg von Tante Moni und den wenigen Freunden, die sie hatte, weil sie so gerne anderer Leute Kinder betreute! Die Wahrheit war: Kinder machten ihr oft ein wenig Angst. Sie waren so wenig kalkulierbar wie sie selbst es war. Sie machte das hier nicht, weil sie Kinder so sehr mochte, nein. Sie wollte keinen sozialen Beruf ergreifen oder Erzieherin oder Kinderpflegerin werden, sondern... Archäologin. Immer noch. Das war es: sie war hier, um die Eigenständigkeit und Reife nachzuholen, von der sie meinte, dass sie ihr für ein Leben als selbst organisierte Studentin fehlte. Ein wenig mehr Aufgeschlossenheit und Selbstbewusstsein wollte sie sich erarbeiten. Sie brauchte das für ihre Pläne mit der Welt da draußen.
Genau genommen war das die eigentliche Arbeit, die sie hier suchte, es war... eine innere Arbeit. Es ging nicht um Kinder und Familien, es ging um sie. Ob sie das mit Familienarbeit oder beim Kellnern oder in einer Bibliothek lernte, war im Grunde egal. Allein wegen des Schocks, dass Tante Moni nach Griechenland ging und sie allein übrig blieb, hatte sie sich für dieses AuPair-Ding entschieden - und weil es sich anbot.
Beinahe musste sie jetzt lächeln, als sie sich so plötzlich auf die Schliche kam. Sie hatte ernsthaft gedacht, sie würde sich durch diese Form der Arbeit vor dem Alleinsein retten, denn das war beängstigend gewesen: die Vorstellung, letztlich ganz ohne Familie zu sein, wenn sie sich dagegen entschied, ihre Tante nach Griechenland zu begleiten. Sie war jetzt zwanzig Jahre alt und fühlte sich noch längst nicht reif und stabil genug für ein eigenes Leben - nicht, wenn sie dabei auf niemanden Bezug nehmen konnte. Das verlassene Mädchen in ihr suchte Familienanschluss, während sie zugleich einer Tätigkeit nachging. Darum dieser Job und nicht irgendein anderer.
Was für eine naive Idee war das... Ihre erste Stelle hatte ihr gezeigt, wie sehr man sogar inmitten fremden Familienlebens allein und verlassen sein konnte - und dass das viel schlimmer war als tatsächlich auf sich gestellt zu sein und zu wissen, dass da niemand war. Es gab verschiedene Qualitäten von Alleinsein, das lernte sie gerade. Die Sorte, bei der man von Menschen eng umgeben war, die einen aber nicht wahrnahmen, war die schlimmste. Was also sollte da nun noch schlimmer werden? Und ob es besser war als das letzte, dazu wollte sie so früh lieber nichts hoffen. Das brachte nur Enttäuschung.

Sie stand auf und streckte ihre Beine durch. Auch hier vorne füllten sich nun die Plätze. Es wurde Zeit, dass sie sich am Eingang sehen ließ. Entschlossen schulterte sie ihre Tasche, schnappte sich den Koffer und zog ihn hinter sich her, durch die zweigeteilten Sitzreihen hindurch und bis ins Foyer.
Kurz vor dem Ausgang befand sich der Briefkasten. Der Automat daneben bot Briefmarken nur zu zehn oder zwölf Stück in unterschiedlich sortierten Heftchen an, also wählte sie eines. Die Marke wollte auf dem Umschlag nicht kleben, mehrere Versuche schlugen fehl. Beim letzten fiel ihr auch noch der Brief aus der Hand und schlitterte einer jungen Frau vor die Füße. Sie hob ihn freundlich auf und gab ihn Emma zurück. Die zweite Marke hielt - wenn auch nach einigem Pressen mit dem Finger. Es war, als wehrte sich der Brief partout, abgeschickt zu werden. Oder war sie es selbst? Einen weiteren Augenblick zögerte sie, dann steckte sie ihn durch den Schlitz und ließ los.
Alles darin war gelogen. Weder war sie übermäßig aufgeregt wegen des Fluges gewesen, noch gab es Rosiges über die neue Stelle zu berichten - und auch Hollys Bild war alles andere als eine Freude für sie gewesen. So hatte sie zuletzt mit dreizehn Jahren ihrer Oma geschrieben. Oma Lieschen... die hatte darauf bestanden, dass man sich regelmäßig meldete. Liebe Oma, wie geht es dir, mir geht es gut. In der Schule klappt alles super und ich freue mich schon auf Weihnachten. Was man eben so schrieb, nachdem man seine Mutter beerdigt hatte. In dieser Zeit hatte sie gelernt, solche Briefe zu schreiben. Weil es Leute gab, denen man nicht die Wahrheit sagen konnte. Für Holly und die Chapmans war es eine Notwendigkeit gewesen, das zu tun: Sie konnte hier nur lügen... oder sie enttäuschen.
Ein Getränkeautomat stand an der Seite. Den Eingang im Blick behaltend fischte sie eilig ein paar weitere Münzen aus ihrem Portemonnaie. Es gab Wasser ohne Kohlensäure... Sie hatte gerade heraus gefunden, dass man die Plexiglasscheibe verschieben musste, um an das Wechselgeld heran zu kommen, das der Automat ihr ausspuckte, als sie aus dem Augenwinkel bemerkte, dass ein Mann die Halle betrat. Das wäre nicht weiter bedeutsam gewesen, wenn er nicht ohne Gepäck gekommen und nicht zwei, drei Meter nach der Tür schon wieder stehen geblieben wäre. Er war mittelgroß. Unter dem Hut, den er tief ins Gesicht gezogen hatte, schätzte sie ihn auf fünfundfünfzig Jahre, vielleicht älter. Suchend sah er sich um, bis sein Blick schließlich an ihr hängen blieb. Bevor sie es vergaß, griff sie sich ihre Flasche aus der Klappe. Konnte das Mr. Ò Briain sein? Im ersten Moment hielt sie es für unmöglich. Er hatte einen kleinen Sohn, sieben sollte der Junge sein. Aber vielleicht war Mr. Ò Briain ein später Vater. Oder der Kleine ein ungeplanter Nachzügler.
Die Lachfältchen um die Augen und der graue Schatten, der die untere Gesichtshälfte bedeckte, waren das erste, was ihr an ihm auffiel. Über die Distanz hinweg bemühte er sich um ein Lächeln, Emma wusste nicht genau, ob es echt oder aufgesetzt war, vielleicht wollte er einfach nur freundlich sein. Er sah einigermaßen sympathisch aus, wie er da mit diesem fragenden Blick auf sie zu steuerte, aber in seiner Haltung lag etwas, das sich mit Unruhe oder Hektik am besten beschreiben ließ. In seinen Gedanken schien er nebenbei woanders zu sein.
"Sperling", fragte er, als er schließlich vor ihr stehen blieb, "...Emma Sperling, Germany?"
Ende Teil 7
FÜR HÖRBUCH-FANS:
SHADOW HALL gibt es jetzt auch als Hörbuch auf meinem YT Autorenkanal, ebenso wie meine anderen Werke. Den Link zum Kanal (Bettina Deutsch Autorin) findet Ihr unter dem Text meines Wattpad Profils.
Manche Wattpad Leser sagen, die Hörbücher seien besser, u.a., weil sie "näher dran" sind als die Wattpad Buchtexte. Über dem nächsten Kapitel findet Ihr einen Link zum entsprechenden Kapitel in der Hörfassung. Ausprobieren! ;-)
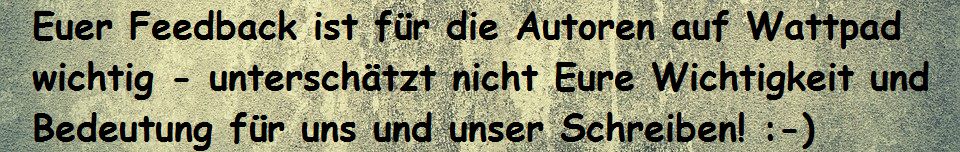
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro