11. Kapitel
Wär mir's nicht untersagt,
das Innre meines Kerkers zu enthüllen,
so höb ich eine Kunde an, von der
das kleinste Wort die Seele dir zermalmte,
dein junges Blut erstarrte, deine Augen
wie Stern' aus ihren Kreisen schießen machte,
dir die verworrnen krausen Locken trennte
und sträubte jedes einzle Haar empor
wie Nadeln an dem zornigen Stacheltier:
Doch diese ewige Offenbarung faßt
kein Ohr von Fleisch und Blut.
William Shakespeare
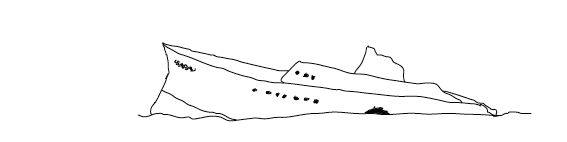
Immer weiter schleppte Tai sich nach Westen. Tagsüber versteckte er sich im Schatten von Felsen und versuchte zu schlafen, was aber kaum möglich war, da die Sonne heiß auf seinen ganzen Körper brannte. Er hatte weder Wasserschlauch noch weiteren Proviant dabei. Alles, was ihm geblieben war, war die Kleidung an seinem Leib und Muuajis Säbel, für den er nicht mal eine Scheide hatte. In der Dämmerung und nachts wanderte er immer weiter nach Westen, auf geradem Weg fort von Chuma Chakavu. Den Rauch konnte er mittlerweile nicht mehr sehen. Dafür fühlte er den Schmerz um seinen Verlust umso deutlicher.
Sind sie wirklich alle tot? Immer wieder fragte er sich das. Er hatte sie mit eigenen Augen gesehen, die Leichen, aber nicht alle. Wo ist Maua? Hat sie überlebt? Wenn ja, wo ist sie? Verzweifelt strich er sich über die schwarzen Stoppel auf seiner Kopfhaut. Wenn ich doch nur einen Anhaltspunkt hätte, um nach ihr zu suchen! Er klammerte sich an die Hoffnung, dass die Plünderer sie nicht erwischt hatten und sie rechtzeitig hatte fliehen können. Etwas anderes war nicht möglich. Es war offensichtlich, dass die Plünderer keine Gefangenen nahmen. Sie hatten sogar Kinder getötet. Kinder wie Mjuvi...
Durch Ndeges Lektionen hatte Tai gelernt, wie man in der Einöde Wasser fand. Das kam ihm nun zugute. Nach zwei Tagen der Wanderung unter der brennenden Sonne fand er völlig erschöpft ein kleines Untier, das über den ockerfarbenen Sand huschte. Sofort nahm er die Verfolgung auf – erleichtert darüber, dass es nur ein kleines war und nicht etwa ein Monster wie die Zwitternager, von denen Muuaji erzählt hatte. Das kleine Wesen blieb irgendwann stehen und fing an zu graben. Mit einem Schrei sprang Tai nach vorne und schlug nach dem Untier, das nur erschrocken quiekte und dann floh.
Gierig fiel er in den Sand, grub mit beiden Händen an der Stelle, an der das Untier offenbar Wasser gespürt hatte. Sein Atem ging keuchend, seine Kehle kratzte vor Trockenheit. Und dann – endlich! – trafen seine Finger auf härteren Sand. Sand, der wegen seiner Feuchtigkeit zusammenklebte. Kleine Körner bohrten sich unter seine Fingernägel, scharf wie Nadeln, bis es zu sehr schmerzte. Aus Verzweiflung nahm er Muuajis Säbel zu Hilfe. Lockerte damit den Sand und hob ihn aus der Kuhle, bis sich unten eine kleine Pfütze aus dreckigem Wasser gebildet hatte. Zitternd beugte er sich hinab und kostete davon. Es schmeckte abgestanden und er spürte knirschende Sandkörner zwischen seinen Zähnen, aber das war ihm egal. Hauptsache, er konnte etwas trinken.
Nachdem er seinen Durst halbwegs gestillt hatte, schnitt Tai sich ein Stück seines Hemdes ab, tunkte es in das Wasser und wickelte sich den nassen Fetzen um den Kopf. Sofort wurden seine Gedanken klarer, doch das Kratzen in seiner Kehle war geblieben. Oder war es eher die Haut an seinem Hals, die juckte? Vorsichtig tastete er nach der Stelle und fand tatsächlich einen Schorf. Wahrscheinlich habe ich mich da irgendwann verletzt ohne es zu bemerken. Wenigstens ist die Wunde schon verheilt.
Im unsteten Dämmerlicht wanderte Tai weiter. Eines Nachts entdeckte er am Horizont flackernde Lichter. Sie waren über eine so große Fläche verteilt, dass es unmöglich ein Dorf sein konnte, eher eine Stadt. Mit einem neuen Ziel vor Augen kam er schneller voran. Dennoch kamen der Durst und auch der Hunger bald wieder und als er am Stadttor ankam, hatten die Wächter so viel Mitleid mit ihm, dass sie ihm zuerst von ihren eigenen Vorräten gaben.
»Junge, Junge!«, rief einer von ihnen aus. »Was ist denn mit dir passiert? Warum zum Henker warst du alleine in der Einöde? Und ganz ohne Proviant!«
Tai antwortete erst, als er einen Großteil des Wasserschlauchs ausgetrunken hatte. Dankend reichte er ihn dem Wächter zurück und rückte den Stofffetzen zurecht, den er mittlerweile nicht mehr um den Kopf gewickelt hatte, sondern als Halstuch benutzte.
»Mein Zuhause wurde angegriffen«, erklärte er vage. »Alle sind gestorben. Ich musste fliehen.«
»Angegriffen?« Der erste Wächter sah den anderen vielsagend an. »Und du willst immer noch behaupten, dass es eine gute Idee des Königs war, Mwenyue Ukoma zu errichten? Jetzt siehst du, wozu das führt! Die Strahlenkranken denken, dass sie überall im Ostland willkommen sind und es ihr Recht ist, sich bei gesunden Leuten rumzutreiben! Es hatte schon seinen Sinn, dass sie ins Grenzland verbannt wurden!«
»Ich hab dir schon vor fünf Tagen gesagt, dass ich jetzt anders denke«, erwiderte der zweite Wächter leicht verärgert. »Wo der König doch offensichtlich verrückt geworden ist...«
»Verrückt geworden?« Tai horchte auf. Die falsche Vermutung über die Strahlenkranken, die er eigentlich berichtigen wollte, war ganz vergessen. »Der König?«
»Ja«, bestätigte der erste Wächter. »Er redet scheinbar mit sich selbst und ist paranoid geworden. Er möchte jeden zum Tode verurteilen, der etwas gegen seine Höllenmenschen sagt. Und er soll sogar einen Stallburschen so heftig verprügelt haben, dass dieser jetzt nicht mehr arbeiten kann.«
Der andere Wächter schüttelte den Kopf. »Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Dabei hat er das Ostland davor bewahrt, vom Südland erobert zu werden.«
»Und gleich darauf ist er mit dem Nordland in den Krieg gegen die Triglaza gezogen. Du kannst vieles behaupten, aber nicht, dass sich durch ihn alles zum Guten gewendet hat.«
Der andere Wächter zuckte nur mit den Schultern.
»Wie auch immer.« Der erste wandte sich wieder an Tai. »Du hast aber keinen der Strahlenkranken berührt, vor denen du geflohen bist, oder?«
Tai schüttelte den Kopf. »Nein. Genauer gesagt waren es auch keine Strahlenkranken. Es waren Plünderer.« Mit neuer Hoffnung deutete er nach Südosten, wo Chuma Chakavu liegen musste. »Dort gibt es einen großen Schiffsfriedhof, der von Menschen bewohnt wird, die...«
»Die Buren?«, unterbrach ihn der erste Wächter scharf.
»Ja.« Verwirrt schaute Tai von einem zum anderen. »Kennt ihr sie?«
»Und ob wir sie kennen. Sie sind der Grund dafür, dass sich niemand in die Gegend traut, in deren Richtung du eben gezeigt hast. Die Buren überfallen Leute, nehmen ihnen ihren Proviant weg und töten sie dann, damit sie nicht qualvoll in der Einöde verdursten müssen. Eine tolle Gnade ist das!«
»Das stimmt nicht!«
»Natürlich stimmt das!« Der erste Wächter runzelte wütend die Stirn. »Das haben sie dir nicht erzählt, oder? Haben sie dir stattdessen berichtet, dass sie alle laufen lassen? Nun, keiner von ihnen ist je wieder hier in Kosa angekommen!«
»Sie bieten ihnen an, sich den Buren anzuschließen!«, widersprach Tai. »Aber bisher haben alle versucht zu fliehen und man hat sie nur getötet, damit sie anderen nichts von den Buren-Geheimnissen erzählen!«
»Bist du dir sicher, dass du von normalen Stadtmenschen sprichst?«, fragte der Wächter. »Keiner von uns verspürt den Drang, unbedingt in Wracks zu übernachten, die vollkommen schutzlos mitten in der Einöde liegen. Wo es nur so von Untieren wimmelt. Natürlich werden sie fliehen! Die Buren wissen das und haben nur mit ihnen gespielt. Aus welchen Gründen auch immer.« Er kniff misstrauisch die Augen zusammen. »Du bist also ein Bure. Hast du deshalb so kurze Haare?«
Tai biss die Zähne zusammen. Er hatte gewusst, dass die Buren Menschen töteten, aber Ndege hatte gesagt, es wären nur Diebe und Spione der Plünderer gewesen. Unmöglich, dass sie auch wehrlose Stadtmenschen einfach töten! Als sie mich gefunden haben, wollten sie auch nur den Proviant und hätten mich ansonsten gehen gelassen!
»Und warum kratzt du dich die ganze Zeit am Hals?«, wollte der zweite Wächter wissen. »Zeig uns, was du unter deinem Tuch hast!«
Tai hatte gar nicht gemerkt, dass er wieder angefangen hatte, sich zu kratzen. Widerwillig schob er das Tuch beiseite. »Es ist nur eine heilende Wunde«, sagte er. »Und ja, ich gehöre zu den Buren, aber sie würden nie...«
Er verstummte, als beide Wächter entsetzt vor ihm zurückwichen. Der erste schleuderte den Wasserschlauch, aus dem Tai eben getrunken hatte, weit von sich weg als wäre er ein Untier.
»Ruft den Kahata!«, brüllte der andere die Stadtmauer hoch, wo vermutlich weitere Wachmänner warteten. »Sofort!«
»Was...?«
»Beweg dich kein Stück vom Fleck!«, fuhr der erste Wächter Tai an, zog gleichzeitig sein Schwert und richtete die Spitze auf ihn. Der andere tat dasselbe. »Wenn du versuchst zu fliehen, bist du ein toter Mann!«
»Was soll das alles?«, rief Tai. Sein Herz pochte wie verrückt. Die scharfe Klinge war zu nah an seiner ungeschützten Brust und selbst wenn er Muuajis Säbel rechtzeitig vom Boden aufheben könnte: Gegen zwei Gegner auf einmal hatte er keine Chance.
Keiner der beiden antwortete. Es verging einige Zeit, bis ein weitere Wächter in Begleitung eines Mannes auftauchte. Letzterer trug keine Rüstung und war auch nicht bewaffnet. Stattdessen trug er vollkommen schwarze Kleidung, die jede Stelle seines Körpers bis auf das Gesicht verdeckte. Auf der Brust prangte eine silberne Brosche, die etwas zeigte, was vermutlich eine Blume darstellen sollte. Jedenfalls ähnelte es dem Unkraut, das manchmal auf den Maisfeldern wuchs.
»Ist er das?«, fragte der seltsame Mann und ging, ohne eine Antwort abzuwarten, an den beiden wartenden Wächtern vorbei. Seine dunklen Augen funkelten und er musterte Tai aufmerksam von oben bis unten. »Wo ist es?«
»An seinem Hals, Kahata.«
Tai wich zurück, als der Mann seine behandschuhten Hände nach ihm ausstreckte. Doch als die Spitzen der Schwerter näher kamen, gab er jede Gegenwehr auf. Der Stofffetzen wurde zur Seite geschoben, woraufhin der Mann in Schwarz mitleidig seufzte und nickte.
»Ihr tatet gut daran, mich zu holen. Wartet hier, bis ich mit dem Wagen zurückkomme.«
»Mit dem Wagen?« Tai spürte eine unglaubliche Angst in sich aufsteigen. »Was geht hier vor sich? Was ist mit mir? Was ist an meinem Hals!« Er fürchtete sich vor der Antwort und wusste zugleich, dass diese Reaktionen nur durch eines erklärt werden konnten.
»Du hast die Strahlenkrankheit«, bestätigte der Mann in Schwarz. Aus einer Hosentasche holte er einen Gegenstand, den er aufklappte und Tai schräg vor das Gesicht hielt. Es war ein Spiegel, in dem er nun die schreckliche Wahrheit sah. Es war kein Wundschorf, den er gespürt hatte, sondern ein schwarzes Geschwür, das sich auf seiner ansonsten reinen Haut gebildet hatte. Ein Zeichen der Strahlenkrankheit.
»Das kann nicht sein«, flüsterte Tai, obwohl er genau wusste, dass es sehr wohl möglich war.
»Das sagen die meisten.« Der Mann seufzte wieder. »Tut mir leid, aber du darfst dich nicht hier aufhalten, wenn du strahlenkrank bist.«
Jetzt wurde Tai wütend. Ungeachtet der Schwerter, die auf ihn gerichtet waren, packte er den Mann am Unterarm und hielt ihn fest. Sofort spürte er kaltes Eisen an seinem Nacken.
»Keinen Schritt weiter!«, warnte einer der Wächter ihn. »Und lass den Kahata los!«
Doch Tai dachte nicht daran. »Was passiert jetzt mit mir? Ihr könnt mich nicht einfach ins Grenzland verbannen! Das gleicht einem Todesurteil! Und ich werde garantiert nicht nach Mwenyue Ukoma gehen!«
»Das liegt nicht an dir zu entscheiden«, beruhigte der Mann ihn, bedeutete den Wächtern, ihre Schwerter sinken zu lassen, und löste vorsichtig Tais Griff. Er deutete auf die silberne Brosche. »Ich bin ein Kahata, ein Sammler der Hoffnungslosen. Du kannst mich Kahata Sahihi nennen.«
»Wohin wirst du mich bringen? Wohin?« Um ihn herum schien die Welt zusammenzubrechen. Gerade erst war er dem Albtraum in Chuma Chakavu entkommen und jetzt steckte er schon im nächsten. »Ich werde nicht mitkommen!«
»Wenn du dich weigerst, wartet der Tod auf dich«, erklärte Kahata Sahihi sachlich. »Du bist jetzt ein Strahlenkranker und eine Gefahr für andere Menschen. Deine Krankheit ist nicht so weit fortgeschritten. Also kannst du deinem Land noch von Nutzen sein.«
»Was? Wie?« Tai verstand gar nichts mehr. Weder im Grenzland noch in Mwenyue Ukoma brachten die Strahlenkranken irgendeinen Nutzen. Sie waren eine Last für alle und jeden.
»Es wird dein letzter Dienst an dein Land sein«, sagte der Kahata.
Tai atmete tief durch. Dann bückte er sich, packte den Säbel und riss ihn blitzschnell nach oben. Er schaffte es noch, Sahihi am Ärmel zu erwischen, bevor einer der Wächter ihm seinen Fuß in die Kniekehle rammte und ihn so zu Fall brachte. Der andere trat seine Waffe aus seiner Hand, die über den Sand davon schlitterte.
»Ich verstehe, dass es schwer ist, das zu akzeptieren«, meinte der Kahata ruhig, als wäre eben nichts passiert. An die Wächter gewandt fügte er hinzu: »Sorgt dafür, dass er nicht wegläuft, bis ich mit dem Wagen komme.« Ohne ein weiteres Wort schritt er davon, zurück in die Stadt.
Kifo!, fluchte Tai im Stillen, während er weiterhin am Boden lag. Ich hätte sein Wrack nie betreten dürfen! Alles war verseucht! Es war hoffnungslos. Tränen der Verzweiflung stiegen in ihm auf, aber er blinzelte sie weg. Ich werde fliehen! Niemals werde ich ins Grenzland oder nach Mwenyue Ukoma gehen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro