z w e i
Ich war anders als meine Klassenkameraden. Als ich das irgendwann in meiner frühpubertären Phase begriff, folgte sogleich eine weitere Erkenntnis. Ich würde nicht glücklich werden, wenn ich mein Leben so weiter lebte, wie ich es bisher getan hatte – wenn ich vorgab, jemand zu sein, der ich nicht war; mich bei jedem Wort, das ich sagte, und jeder Bewegung, die ich tat, verstellte. Also begann ich, meine Lebensweise zu ändern. Erlaubte mir endlich, ich zu sein. Ob mich dies hingegen glücklich machte, stellte ich zwar ebenfalls schon bald in Frage, allerdings war es noch immer besser, als diese ständige Falschheit, wenngleich ich von nun an ein Außenseiter war. Meine Klassenkameraden verbrachten die Pausen vorwiegend damit, über Lehrer und Mitschüler abzulästern oder über die neuesten Trends zu diskutieren, während ich mich am liebsten hinter einem Buch verkrochen hätte. Doch das konnte ich natürlich nicht. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn ein Lehrer Wind davon bekäme.
Meine Mitschüler zogen mich mit meiner Verschlossenheit und meiner für sie mehr als nur seltsamen Art auf. Erst waren es nur blöde Sprüche, die sich jedoch recht schnell zu bösartigen Beschimpfungen entwickelten. Und so saß ich den Großteil der Pause auf einer Bank unter einem Baum und versuchte, die Kommentare der Anderen zu ignorieren, indem ich mich in meinen Fantasien versteckte. Ich wusste, dass das auf die Dauer keine Lösung war, denn je tiefer ich in meine Welten sank, desto mehr machten sich meine Mitschüler über mich lustig, da sie es genau merkten, wenn ich wieder einmal nur körperlich anwesend war. Eine andere Lösung des Problems kam mir jedoch selbst mithilfe meiner Kreativität nicht in den Sinn. Mutig genug, um mich gegen die Kommentare der anderen Kinder zu wehren, war ich nicht. Und so fraß ich alles in mich hinein und flüchtete mich in meine Fantasiewelten. Tat so, als würden mir die Sticheleien nichts ausmachen; versuchte, den Anschein zu erwecken, dass mir überhaupt niemand etwas anhaben konnte. Tag für Tag hoffte ich, dass es irgendwann besser werden würde, obwohl mein Verhalten die Situation zusehends verschlimmerte. Erst zu Hause verschwand ich in meinem Zimmer und weinte den ganzen Nachmittag, weil ich mich so alleine fühlte – außer meiner Großmutter hatte ich schließlich niemanden.
Dann, an diesem einen Tag im Juli, sollte meine rebellische Phase ihren Höhepunkt erreichen. Der Morgen hatte bereits bescheiden angefangen und aus einem mir schleierhaften Grund hatte ich seit dem Frühstück so ein seltsames Gefühl in der Magengegend, als würde sich etwas Schlimmes anbahnen. Aber was das sein sollte, wollte sich mir ebenfalls nicht offenbaren. Ich vermutete, dass ich einfach schlecht drauf war, weil ich zuerst verschlafen hatte und dann fast zu spät in die Schule gekommen war. Und dann war da natürlich noch die Pubertät. Die erklärte viel zu oft alle Launen und jedes Dilemma.
Wie es schien, hatte ich damals, mit dreizehn Jahren, noch nicht gelernt, in den entscheidenden Momenten auf mein Bauchgefühl zu hören. Den gesamten Unterricht lang versuchte ich, das Ziepen zu ignorieren und glaubte schließlich, dass ich mir alles nur eingebildet hatte. Erst in der Pause musste ich feststellen, dass es sich dabei nicht um eine Wahnvorstellung gehandelt hatte. Wie jeden Tag war ich die letzte im Pausenhof und quetschte mich zwischen den vielen Schülern hindurch – stets darauf bedacht, so unscheinbar wie möglich zu wirken. Als ich endlich meine Stammbank erreicht hatte, ließ ich mich seufzend darauf nieder, schob meine Brille, die mir bei fast jeder schnellen Bewegung beinahe zu Boden fiel, zurück auf die Nase und nestelte nachdenklich an meiner blütenweißen Schuluniform herum. Blickkontakt mied ich so gut es ging, um niemanden auf mich aufmerksam zu machen.
In der nächsten Schulstunde stand ein Mathematiktest an. Die Formeln konnte ich mir nie merken und so schaltete ich mein Tablett an, um das Thema ein letztes Mal zu wiederholen. Ich musste mich anstrengen. In der letzten Klausur hatte ich nur vierzig Punkte erhalten. Das musste ich unbedingt ausgleichen.
Seit etwa fünfzig Jahren gab es ein neues Notensystem, das auf der ganzen Welt gleich war. Die Noten wurden in Punkten auf einer Skala von null bis hundert angezeigt. Hatte man in einer einzigen Arbeit unter zwanzig Punkte, musste man das gesamte Schuljahr wiederholen. Zudem war es Pflicht, mindestens drei Stunden Nachhilfe pro Woche in diesem Fach zu nehmen. Jeder wollte das Schulsystem so schnell wie möglich verlassen und so lernten die meisten auch recht viel. Als Kindheit konnte man seine Schulzeit also kaum mehr bezeichnen. Oft war ich bis nach Mitternacht an meinen Hausaufgaben gesessen und kaum jemandem ging es anders. Nur wenige boykottierten das Schulsystem, indem sie zehn Jahre oder länger in einer einzigen Klassenstufe verbrachten. Denn auf diese warf die Regierung meist ganz besonders ein Auge, um zu verhindern, dass diese Rebellen einen Aufstand wagten. Gerade wenn man illegalerweise noch seine Fantasie besaß, konnte man es sich eigentlich nicht leisten, aufzufallen.
Nach fünf Minuten musste ich feststellen, dass es keinen Sinn mehr machte. Meine Wissenslücke würde sich in einer einzigen Pause nicht füllen lassen. Darüber hinaus hatte ich den ganzen gestrigen Abend gebüffelt und konnte jetzt dringend etwas Abwechslung gebrauchen.
Obwohl ich mir über die Konsequenzen bewusst war, nahm ich all meinen Mut zusammen und zog das Notizbuch und meinen Füller aus meinem weißen Schulrucksack. Ich wusste genau, was meine Großmutter dazu sagen würde und im Nachhinein frage ich mich, was zur Hölle eigentlich in mich gefahren war. Doch ich war es leid, mich allen anderen anzupassen oder einfach nur dazusitzen und so ein noch größeres Opfer für meine Mitschüler darzustellen. Wenn sie sahen, dass ich mich selbst beschäftigen konnte, dachten sie wenigstens, dass ich keine Freunde brauchte, um glücklich zu sein. Obgleich das nicht stimmte. Ich hätte fast alles für eine beste Freundin gegeben.
Alles außer meiner Fantasie.
Nachdem ich noch einmal einen prüfenden Blick über beide Schultern geworfen hatte, um mich zu vergewissern, dass ich unbeobachtet war, griff ich nach meinem Füller und setzte ihn vorsichtig auf das weiße Papier. Eigentlich war ich Linkshänder, aber in der Schule mussten wir mit rechts schreiben – schließlich sollte ausnahmslos jeder gleich sein. Allerdings ignorierte ich diese Regel in meiner Freizeit wohlweislich und schrieb mit der linken Hand, mit der ich nun behutsam winzige Buchstaben in das Notizbuch malte. Ein kleiner blauer Punkt leuchtete darauf auf wie ein Stern in einer dunklen Nacht; wie ein winziger Hoffnungsschimmer zwischen purer Verzweiflung. Er wurde zu einer Linie, die Linie zu einem Buchstaben, dieser wiederum zu einem Wort, das Wort zu einem Satz. Und der Satz mit vielen anderen schließlich zu einer Geschichte. Wenn ich schrieb, dann wie eine Besessene. Es war, als würden die Worte zusammen mit der Tinte aus meinem Füller fließen, um sich in meinem Notizbuch zu verewigen. Als würde ich gar nicht selber schreiben; als stünde jemand hinter mir und flüsterte mir alles ein, jeden einzelnen Buchstaben. Wort für Wort. Satz für Satz. Bald hatte ich zwei Seiten mit tintenblauen Worten gefüllt, die alle zusammen eine Geschichte erzählten. Von Hass und Enttäuschung; von Schwäche und Schmerz; und von Trauer und Hoffnungslosigkeit. Aber auch von Freundschaft und Liebe; von Hoffnung und Freude; und von Mut und Stärke. Fasziniert strich ich mit den Fingern über die Seiten. Ich konnte mich einfach nicht daran gewöhnen, nichts als das glatte Papier zu spüren. Durch die vielen Worte und deren Macht hätten die Seiten weich wie Gras, kalt wie Eis, heiß wie Feuer, rau wie Baumrinde, nass wie Wasser und uneben wie ein Gebirge sein sollen. Doch die Seiten blieben glatt. Dabei beschrieben die Worte doch all das und noch viel mehr. Sie verbargen so vieles, von dem selbst der Schreiber nichts wusste, ja, nicht einmal etwas ahnte. Und obwohl die Menschen selbst die Worte erfunden hatten, würde wohl nie auch nur ein Mensch sie vollkommen ergründen können.
Ich hatte schon drei Seiten geschrieben, als ich eine wohlbekannte Stimme vernahm. Ohne aufzusehen, wusste ich, dass es Selina mit ihrer Clique war, die vor mir stand. Schnell klappte ich mein Notizbuch zu und ließ es zusammen mit dem Füller in meinen Rucksack gleiten.
Doch zu spät.
»Was ist das denn, Julia?«, fragte Selina herablassend und hob eine perfekt gezupfte Augenbraue. Sie hatte braune, hüftlange Haare, die sie immer zu einem Pferdeschwanz zusammenband, und eine Figur, von der zahlreiche Mädchen nur träumen konnten. Mich eingeschlossen. Denn während andere in meinem Alter zahlreiche Diäten austesteten, um ihr Wunschgewicht zu erhalten, war an mir alles einfach nur knochig und dünn. Von fraulichen Kurven nichts, aber auch gar nichts zu sehen. In meinen Augen glich ich einem Stock, wenngleich Großmutter das Gegenteil zu behaupten pflegte. Aber schließlich musste man seine eigene Enkelin hübsch finden.
»Nichts«, murmelte ich schnell. Kälte füllte mit einem Mal mein gesamtes Inneres aus und alles in mir zog sich vor Angst zusammen – Angst vor dem nächsten fiesen Kommentar oder noch Schlimmerem.
Mila, Selinas Freundin, verschränkte die Arme vor der Brust. »Aha. Nichts.« Sie schlenderte auf mich zu und ehe ich reagieren konnte, hatte sie sich auch schon meinen Rucksack geschnappt.
»Hey!«, rief ich halbherzig. »Lass das bitte!«
Selina lachte schallend. »Lass das bitte!«, äffte sie mich nach und wischte sich mit zitterndem Kinn eine imaginäre Träne von der Wange. »Ihr seid so gemein zu mir!« Ihre Freundinnen kicherten blöd.
Ich schluckte meinen Ärger hinunter und versuchte es noch einmal. »Ich meine es ernst!«, rief ich und legte Nachdruck in meine Stimme, die allerdings immer dünner und höher wurde.
Mila zuckte gleichgültig die Schultern und grinste. »Ich auch.« In aller Ruhe begann sie, meinen Rucksack zu entleeren. Als der Großteil auf der Bank verteilt lag, hielt sie meine Tasche über Kopf und schüttelte sie, bis auch die letzten losen Stifte und Bonbonpapiere auf dem Boden landeten. Neugierig begann Mila, sich alles der Reihe nach anzusehen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit löste ich mich aus meiner Starre. Das Entsetzen hatte mich einfrieren lassen. Empört sprang ich auf und war versucht, Mila meine Tasche aus den Händen zu reißen. Doch Selina kam mir zuvor und ergriff blitzschnell meinen Arm. »Halt dich da raus, Bitch! Hat deine Mutter dir nicht beigebracht, dass man Respekt vor anderen Menschen haben soll?« Sie tat, als fiele ihr plötzlich etwas ein und schlug sich mit der freien Hand an die Stirn. »Oh, ich vergaß, du hast ja gar keine Mutter!« Das Mädchen stieß ein gehässiges Lachen aus. Glücklicherweise ließ sie endlich meinen Arm los, schubste mich jedoch gleich darauf so heftig, dass ich stolperte und auf dem Hinterteil landete.
Ich spürte den Schmerz kaum, doch dafür war meine Wut umso größer. In mir kochte es und als ich mich wieder aufrappelte, zitterte ich vor Zorn. Zu spät bemerkte ich die Tränen in meinen Augen. »Lass meine Mutter da raus!«, zischte ich wutentbrannt. Mein Kinn zitterte und mein Herz schlug heftig gegen meinen Brustkorb. Ich hatte die Hände zu Fäusten geballt, die Arme fest seitlich an den Körper gepresst.
Selina ignorierte mich jedoch knallhart. »Wieso ist sie überhaupt gestorben? Wahrscheinlich hat sie dich gesehen und sich umgebracht, weil sie nicht damit leben konnte, ein so hässliches Kind wie dich zu haben, was?«
»Du hast doch keine Ahnung!«, fauchte ich und versuchte dabei, so selbstsicher wie möglich zu wirken, obwohl ihre Wort einen riesigen Stich in meinem Herzen hinterließen – wie alle Gemeinheiten meiner Mitschüler. Wenn ich mein Herz aufzeichnen sollte, wäre es vermutlich voller schwarzer Löcher – allein das Schreiben verhinderte, dass es nicht gänzlich zerfiel.
Die nächsten Worte sagte ich aus voller Überzeugung, ohne darüber nachzudenken, wie sehr ich sie bereuen würde. »Meine Mutter ist für mich gestorben!«
»Ach ja?«, fragte Selina skeptisch und brachte es fertig, gleichzeitig misstrauisch und gelangweilt zu klingen.
Und dann war da einer dieser mir eigentlich fremden Momente, in denen ich sprach, bevor ich dachte. Und es anschließend zutiefst bereute. »Weil sie mir lassen wollte, was ihr alle schon längst verloren habt. Deshalb bin ich auch kein Bisschen eifersüchtig auf eure Eltern, denn wenn ich eine andere Mutter gehabt hätte, dann wäre ich genauso wie ihr. Und darauf kann ich echt verzichten!«
Mila kicherte. »Ganz ehrlich, du glaubst doch nicht wirklich, dass du irgendetwas hast, das wir alle nicht haben, oder? Schau dich doch mal an!«
»Doch«, antwortete ich mit einer Selbstsicherheit, die mich selbst überraschte. »Aber das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Ihr habt nämlich keine Fantasie!«
Noch ehe die Worte meinen Mund vollständig verlassen hatten, stieß ich innerlich einen herzhaften Fluch aus. Ich hasste mich für das, was ich soeben getan hatte, doch zeitgleich erkannte ich, dass es zu spät war. So sehr ich es mir auch wünschte, selbst der schlimmste Fluch konnte meine Worte nicht mehr rückgängig machen.
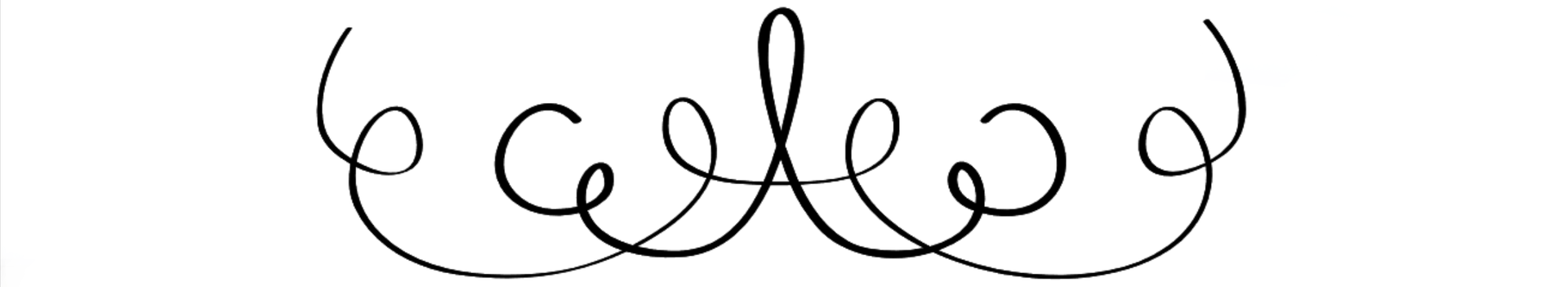
»Was hast du dir bloß dabei gedacht?«, fragte meine Großmutter wieder und wieder. Ruhelos tigerte sie in der Bibliothek auf und ab und machte damit nicht nur mich sondern auch unsere Ratte nervös, die auf dem Teppich saß. Jacys Blick huschte dauernd unruhig zwischen mir und meiner Großmutter hin und her. Seinem müden Blick zu urteilen, hielt er nicht besonders viel von unserem aufgeregten Geplapper, das auch immer wieder im Kreis drehte und den Raum erfüllte, seit ich von der Schule zurückgekehrt und alles gebeichtet hatte.
Ich wusste nichts auf Großmutters Worte zu erwidern, also hielt ich den Mund und wartete darauf, dass sie weitersprach.
»Wenn sie es jemandem erzählt haben, dann kriegen wir ernsthafte Probleme, Luna!« Sie ließ sich erschöpft in ihren Lieblingssessel in der Ecke der Bibliothek fallen und vergrub den Kopf in den Händen.
Ich schwieg weiterhin. Was hätte ich denn auch sagen sollen? Entschuldigt hatte ich mich bereits so oft, dass Großmutter schon vollends entnervt von mir war, und wollte auf keinen Fall riskieren, dass sie richtig wütend wurde. Das würde uns in einer Situation wie dieser keinen Schritt weiter in Richtung einer Lösung bringen.
Großmutter stieß geräuschvoll die Luft aus. »Es gibt nur einen Weg; eine einzige Chance, die uns noch bleibt. Wir müssen von hier verschwinden. Pack das Wichtigste zusammen und in einer Stunde gehen wir, verstanden?«
Ich musste schwer schlucken. Der Gedanke, den Ort, an dem ich aufgewachsen war und meine ganze Kindheit verbracht hatte, schmerzte.
Dennoch nickte ich stumm, mir blieb schließlich auch nichts anderes übrig. Ich allein hatte es verbockt und mal davon abgesehen hing ich auch nicht gerade an dieser Stadt und ganz sicher nicht an meiner Schule und meinen Klassenkameraden. Das Einzige, das ich vermissen würde, war die Bibliothek. Und die Erinnerungen mit Großmutter, die an jedem Möbelstück, jede Blume und jedem Gartenzaun klebten, wie die Seiten alter, staubiger Bücher.
Mit hängenden Schultern schlurfte ich durch den Flur in mein Zimmer, um meine Sachen zu packen, als mich plötzlich die Türklingel aus meinen düsteren Gedanken riss. Vor Schreck zuckte ich zusammen und mein Herz machte einen unkontrollierten, schmerzhaften Hüpfer. Nur einen Wimpernschlag später kam auch meine Großmutter in den Flur gelaufen. Sie war leichenblass. Die Angst stand ihr ins Gesicht geschrieben.
»Sie haben uns gefunden«, wisperte sie und sprach damit aus, was ich partout nicht wahrhaben wollte.
Ich schluckte schwer. »Was sollen wir tun?«
»Ich weiß nicht«, flüsterte sie. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sie ratlos erlebte. Sie, meine weise Großmutter, für die es keine Probleme gab, sondern immer nur Lösungen.
Im Geiste ging ich alle Fluchtmöglichkeiten durch, doch jede Tür und jedes Fenster, das mir als groß genug erschien, um hinaus ins Freie klettern zu können, ging zur Straße hinaus.
Es klingelte noch einmal, diesmal energischer, und zu allem Überfluss begann nun auch jemand, an die Tür zu klopfen.
»Machen Sie auf! Wir wissen, dass Sie hier sind!«, drängen gedämpfte Stimmen zwischen den Türritzen hindurch. Die Worte Jahren mir einen Schauder über den Rücken.
Großmutter schlich zum Eingang und schaltete den Bildschirm der Kamera an, die sie vor Jahren draußen über der Haustür installiert hatte. Draußen standen drei Personen, die leise zu beraten schienen, wie sie weiter vorgehen sollten. Sie trugen Tarnkleidung, weshalb es offensichtlich war, dass sie Soldaten und von der Regierung geschickt worden waren. Das klopfen würde stärker, lauter, aggressiver. Och sah ihre Fäuste heftig auf das Holz der Tür einschlagen. Sie riefen Dinge, die ich nicht verstand und nicht verstehen wollte – vor Angst war ich wie in Trance und konnte nicht mehr klar denken, geschweige denn zuhören. Das alles war allein meine Schuld und ich konnte es nicht mehr gutmachen!
Nie mehr.
Niemals.
Erst Großmutters Stimme brachte mich zurück in die Gegenwart. »Wir haben keine andere Wahl«, wisperte sie. »Wir müssen ihnen aufmachen. Früher oder später werden sie sich ohnehin Zutritt verschaffen«, erklärte sie. »Sie lassen sich nicht von einer sturen alten Frau aufhalten. Und auch nicht von einer Dreizehnjährigen.«
Ihre Worte wurden von einem weiteren langen Klingeln und einem lauten Pochen unterstrichen. Ich sah genau, wie Großmutters Hand zitterte, als sie den altmodischen Knauf umfasste und ihn einmal im Uhrzeigersinn drehte. Dann öffnete sich die Tür mit einem Unheil versprechenden Quietschen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro